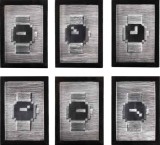Renate Krammer ist vom Phänomen der graphischen Linie bzw. von der auf eine lineare Ordnung reduzierten Formensprache fasziniert. Aber: Was ist eine Linie? Ist sie die Reduktion einer Fläche auf ein infinitesimales Etwas oder die Ausweitung (Aneinanderreihung) von Punkten? Kann es eine flächenlose Linie, eine punktlose Linie, einen flächenlosen Punkt geben? Wenn, dann sicherlich nur in mathematischer und damit abstrakter Idealität – hier kann ein Punkt ein ausdehnungsloses Etwas (= nichts?) sein, das materiell (z.B. graphisch oder malerisch) gar nicht existieren könnte. Ebenso kann es realiter keine Linie geben (man erinnere sich an Cezanne, der meinte, in der Natur gäbe es keine Linie!), denn sie ist ja eine flächenlose Verbindung zwischen zwei Punkten (wenn sie begrenzt ist) oder die Begrenzung einer Fläche (aber nicht die Fläche selbst!). Und sagte nicht schon Leonardo, dass die Grenze ein Nichts sei, und Hegel ergänzte, dass man damit aber immer schon zwei Seiten hätte, nämlich ein Diesund ein Jenseits der Grenze. Und von hier aus ist auch die systemtheoretische Weiterentwicklung dieses Gedankens auf der Grundlage von G. Spencer Browns Formenkalkül verstehbar. Eine Linie ist eine Form, eine Markierung, die immer eine Zwei-Seiten-Form ist. Aber in der Natur gibt es paradoxerweise in Wahrheit keine Grenze, keine Linie! Schon Cezanne forderte alle Zweifler an der Nicht- Existenz der Linie auf: „Zeigen Sie mir etwas Gezeichnetes in der Natur.“ Und damit hatte er vollkommen Recht – in der Natur gibt es einfach keine Linie, weil die Linie per definitionem reine Idealität ist. Deshalb wurde sie auch als graphisches Formelement im Vergleich zu Farbe und Fläche z.B. für W. Kandinsky und P. Klee zum Ausdruck des Geistigen, der Reflexion, des Ideellen. Das graphische Primärelement, das die Linie manifestiert, ist also im Grunde ein Paradox: Sie ist einerseits die absolute Reduktion (auf materieller Ebene) und gleichzeitig eine Erweiterung in die Abstraktion (auf ideeller Ebene). Renate Krammers formale Gestaltungsmittel sind in den vorliegenden Arbeiten – seien es tatsächlich genuine Graphiken oder auch Objekte – großteils auf Lineaturen reduziert, wobei sie diese teilweise noch zusätzlich auf einen einzigen Richtungsvektor – die Horizontale – beschränkt. Beinahe scheint es, als wollte sie vermeiden, dass eine Axialgliederung mit vertikalen und horizontalen Linienführungen schon zuviel an gegenständlicher Assoziation erzeuge. Dieser abstrahierenden Reduktion entspricht auch ihr thematischer Ansatzpunkt. Einerseits geht sie von der immer in Frage stehenden Beziehung zwischen Alltag und Kunst aus, andererseits spezifiziert sie diese Thematik anhand des piktographischen Codes, der ja nicht zuletzt im Zeitalter der Computertechnologie allgegenwärtig, also alltäglich ist. Nicht nur der öffentliche Raum, sondern vor allem die sog. „Benutzer-oberflächen“ unserer digitalen Kommunikationswelt sind ja mit Piktogrammen übersät – vor allem um jenen, die in Wahrheit ja digitale Analphabeten sind, weil sie mit den Programmcodes nichts zu tun haben (wollen), wenigstens ein paar „Handgriffe“ (Anwendungen) zu ermöglichen. Diesen Piktogrammen liegt der Gedanke zu Grunde, auch ohne Sprache Informationen und Bedeutungen vermitteln zu können – quasi selbsterklärend zu sein. Dass in Wahrheit nur wenige Sachverhalte mit eindeutigen ikonischen Chiffren anzuzeigen sind, erfährt jeder an sich selbst, wenn man versuchen wollte, diese inflationären Computer-Icons ohne zusätzlichen Hinweis in ihrer Bedeutung zu entschlüsseln. Erklärbar ist dieser Umstand analog zum „Wesen“ der Linie. Auch Piktogramme sind einerseits Reduktionen einer detailgenauen Darstellung auf das angeblich Wesentliche, aber sie werden andererseits – je reduzierter sie sind – umso abstrakter und damit mehrdeutiger. Renate Krammer geht es zunächst aber darum, wie schnell die einfachsten piktographischen Formen und Zeichen beginnen, den Kommunikationsalltag zu determinieren und zu regeln, wie sehr diese Zeichen aber auch in eine unbewusste Nicht-Wahrnehmung „absinken“, sodass sie als solche, d. h. in ihrer spezifischen Eigenqualität, gar nicht mehr bewusst werden. Je mehr diese graphischen Elemente zu „Schaltstellen“ des Kommunikationsnetzes werden, umso weniger werden sie beachtet. In ihren Kupferdraht-Texturen, die gleichsam das Informationsrauschen unseres Alltags „abbilden“, finden sich einige typische Icons „eingeprägt“ (z. B. „Home“, „Lock“ etc.) – formal einzig und allein durch eine noch stärkere Reduktion der linearen Struktur bestimmt. Hier zeigt sich, dass schon eine geringfügige Differenz alles ist. „Information is a difference that makes a difference“, definierte es G. Bateson. Hier genügt schon die Differenz zweier linearer Ordnungsstrukturen, um einem völlig ignorierten Zeichen neue Bedeutung zu geben. Mit ihrer beinahe meditativ anmutenden Arbeit lässt sie diese unbeachteten Icons zu einer bewusst wahrgenommen Form, also zu einem Gestaltungsphänomen, werden. Wie sehr die reduktive Linearisierung zu einer „Verfremdung“ scheinbar vertrauter Wahrnehmung werden kann, zeigen die graphischen Blätter, auf denen sie das Computer-Icon des sich drehenden Globus in mehreren Ansichtsvarianten, aber in strikt horizontaler Liniengliederung „rekonstruiert“. Die scheinbar „vertraute“ Geographie der Welt zeigt sich „verzerrt“ und fremd – damit aber wird sie auch wieder bewusst wahrgenommen!